

|
Körperfortbewegung – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperfortbewegung“ A118 |
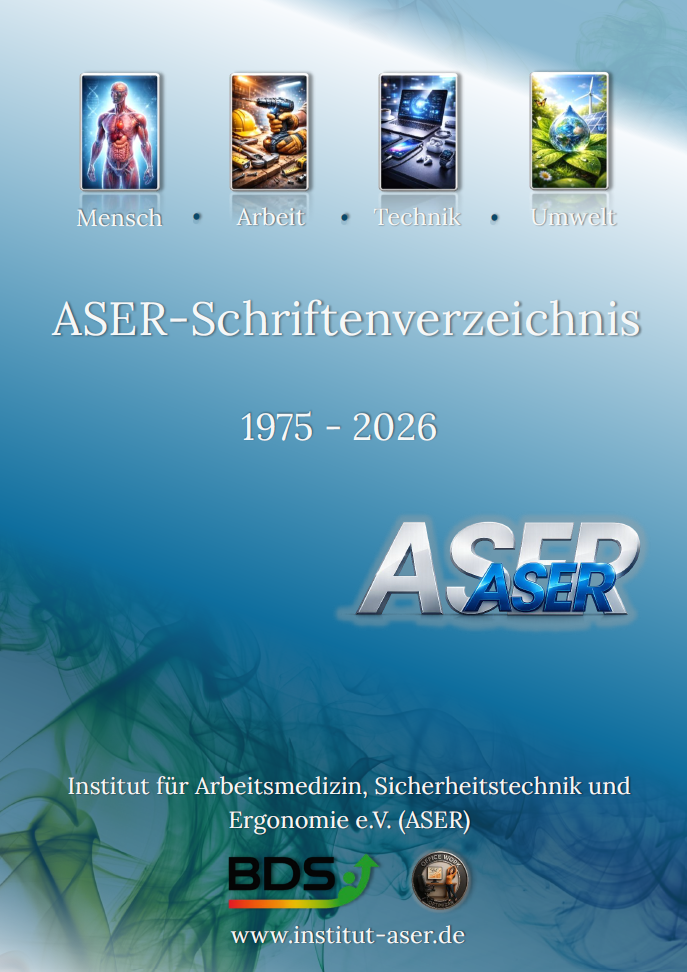
|
ASER-Schriftenverzeichnis 1975 - 2026 Vollständiges Schriftenverzeichnis des Instituts für Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomie e.V. (ASER) beginnend mit dem Erscheinungsjahr 1975. |

|
Ausübung von Ganzkörperkräften – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Ausübung von Ganzkörperkräften“ A114 |

|
Office Work Optimizer (OWO) Der OfficeWorkOptimizer ist ein wissenschaftlich validiertes Analyseinstrument auf Basis des BBM/BiFra-Verfahrens und unterstützt Organisationen bei der effizienten, ergonomischen und gesetzeskonformen Gestaltung von Büro- und Mobilarbeitsplätzen. |
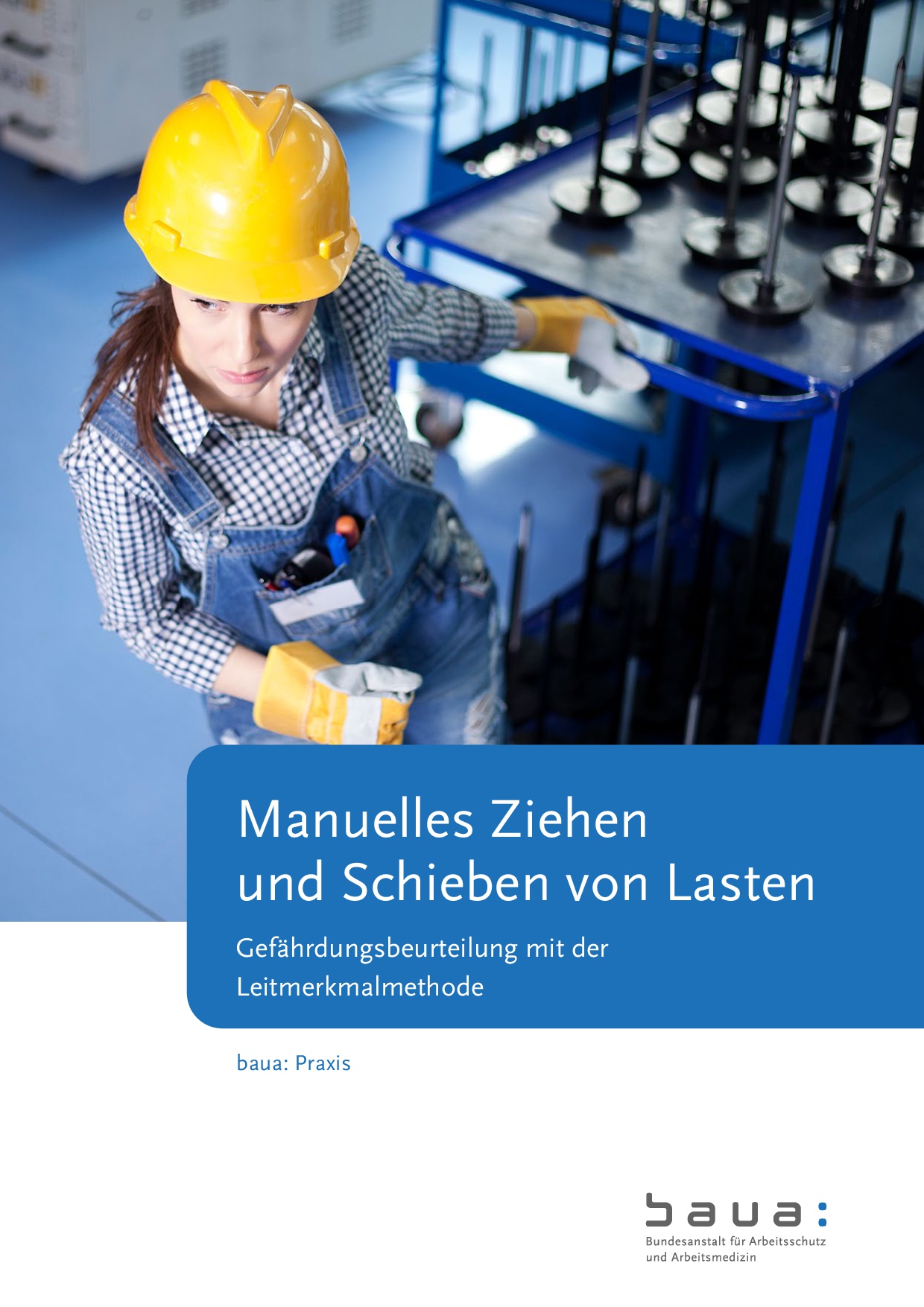
|
Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Ziehen und Schieben von Lasten“ A25 |
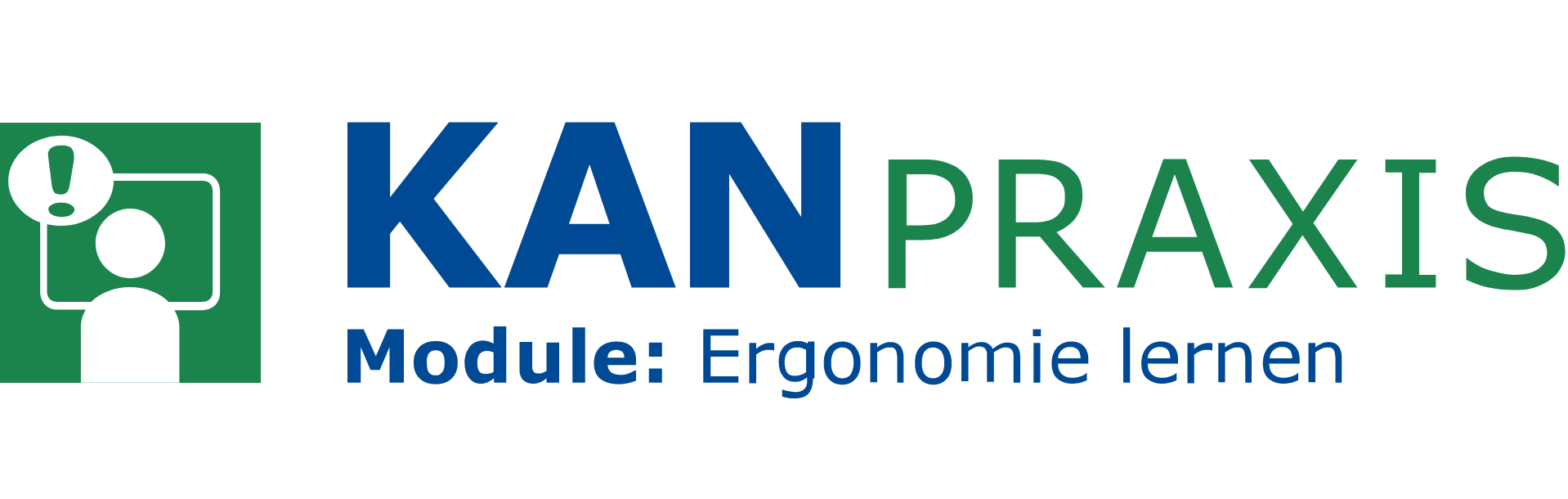
|
KAN-Praxis-Module: Ergonomie lernen Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN), Sankt Augustin |

|
Körperzwangshaltungen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Körperzwangshaltungen“ A111 |
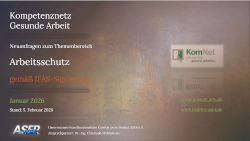
|
KomNet-Neuanfragen zum Themenbereich Arbeitsschutz gemäß IFAS-Signierung Neuanfragen im Januar 2026 im KomNet-Themenbereich Arbeitsschutz, hier Variablen rekodiert gemäß der IFAS-Signierung. Die statistische Auswertung zeigt die absolute Monatsverteilung, hier beispielhaft für den Januar 2026 sowie die relative Verteilung (%) in Bezug auf 25.169 Neuanfragen seit dem Jahr 2016. |
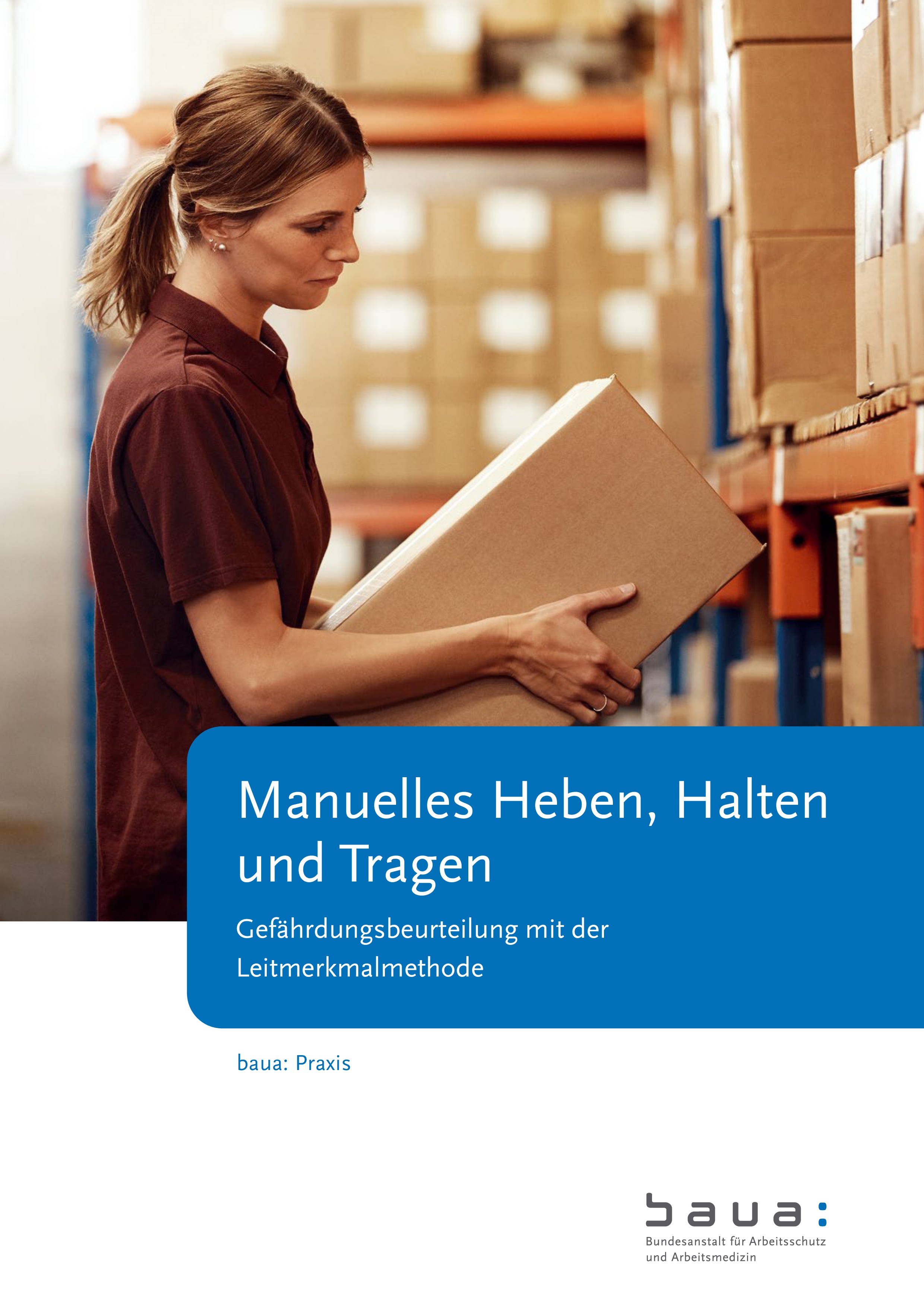
|
Manuelles Heben, Halten und Tragen – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelles Heben, Halten und Tragen“ A7 |
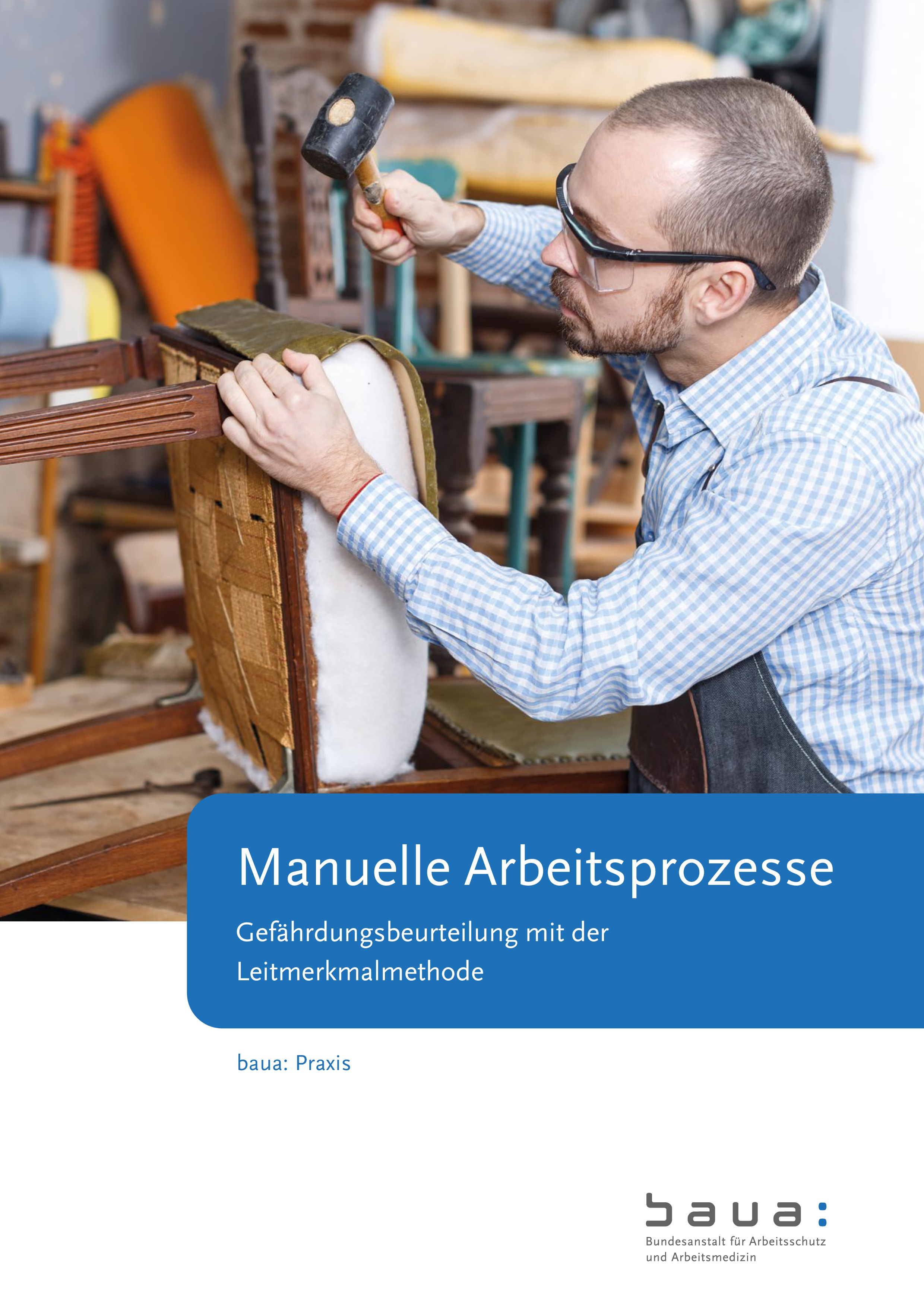
|
Manuelle Arbeitsprozesse – Gefährdungsbeurteilung mit der Leitmerkmalmethode baua: Praxis „Manuelle Arbeitsprozesse“ A55 |
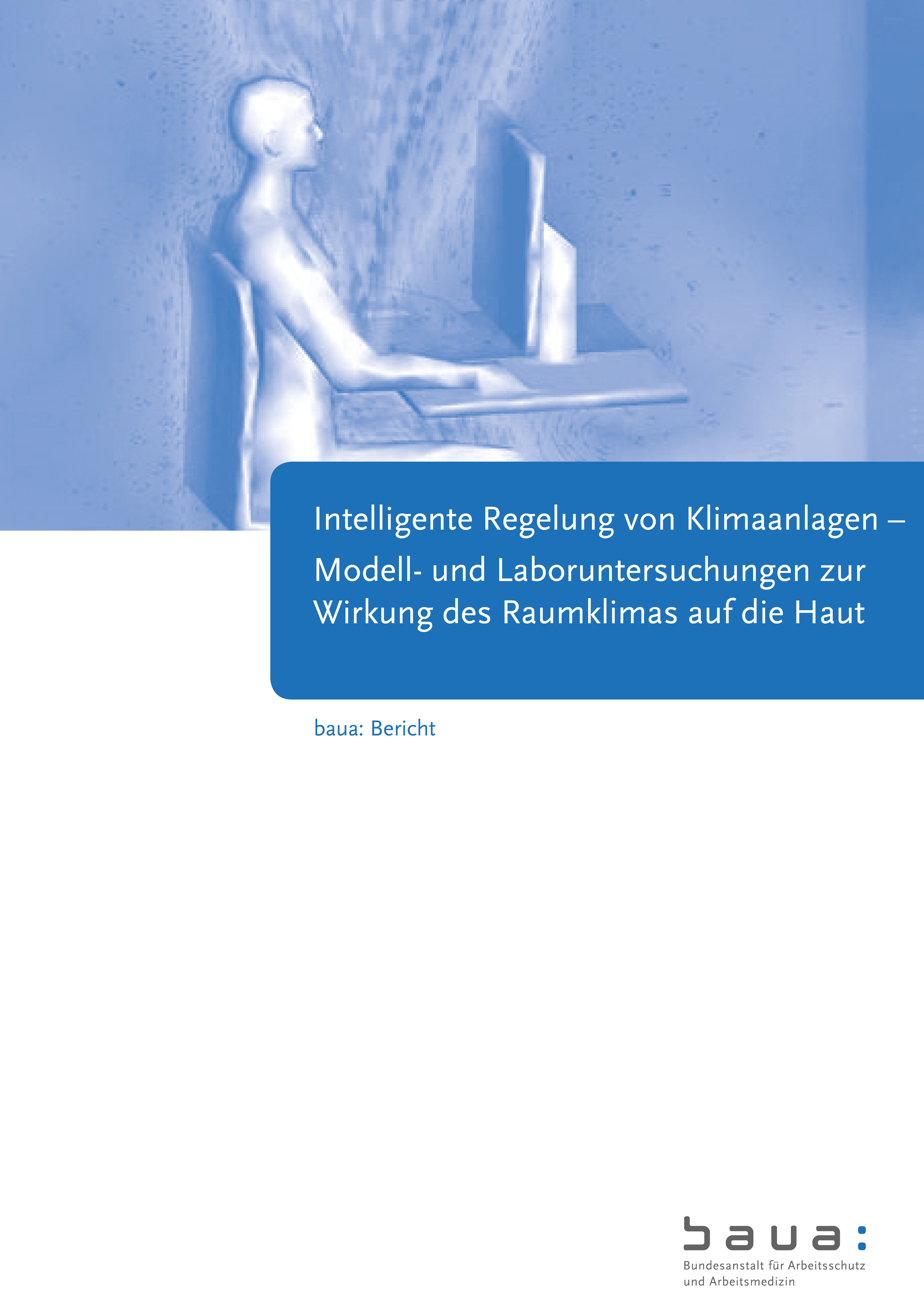
|
Intelligente Regelung von Klimaanlagen - Modell- und Laboruntersuchungen zur Wirkung des Raumklimas auf die Haut Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2299-2 herausgegeben, welches von der TU Dresden und dem Institut ASER e.V. (Wuppertal) durchgeführt wurde. |
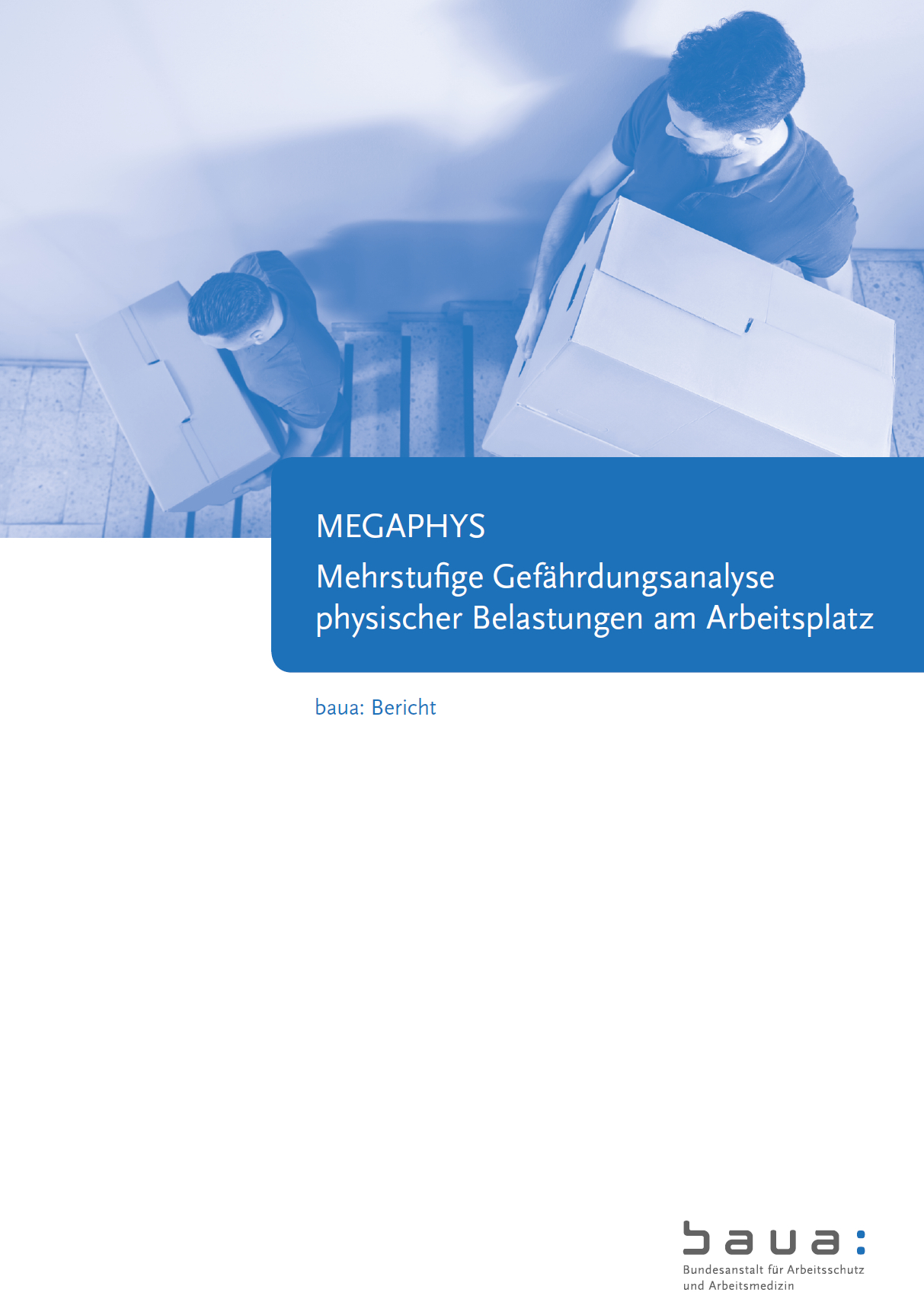
|
MEGAPHYS - Mehrstufige Gefährdungsanalyse physischer Belastungen am Arbeitsplatz (Band 1) Die BAuA hat den Forschungsbericht zum Projekt F 2333 herausgegeben, welches von der BAuA (Berlin), dem Institut ASER e.V. (Wuppertal), der Ebus-Beratung (Berlin) und der ArbMedErgo-Beratung (Hamburg) durchgeführt wurde. |
Veranstaltungen
Mi, 11.03.2026 09:00 UhrMenschengerechte Arbeitsgestaltung
72. GfA-Frühjahrskongress
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.
Veranstaltungsort: Universität Kassel
Mi, 18.03.2026 09:00 Uhr
Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V.
Veranstaltungsort: Universität Kassel
66. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM
66. Wissenschaftliche Jahrestagung der DGAUM
Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.
Veranstaltungsort: LMU Klinikum München
Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.
Veranstaltungsort: LMU Klinikum München
Erläuterungen zur Anwendung des Instruments
1. Aufgabenbereiche
Bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Grossveranstaltungen sind eine Reihe von Aufgabenbereichen organisatorisch sicherzustellen und personell zu besetzen. Diesen, im folgenden ohne Wertung im Überblick dargestellten ist bei der Einsatzplanung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.1.1 Rettungs- und sanitätsdienstliche Betreuung
Die Mitarbeiter in diesem Bereich arbeiten in umittelbarem Kontakt zu den Besuchern und Teilnehmern der Veranstaltung. Die erste Stufe der Versorgung ist eine rein sanitätsdienstliche Betreuung. Dieser von den medizinischen Moeglichkeiten eher einfach strukturierte Versorgungsstufe kommt im ersten Kontakt für die Betroffenen eine Schlüsselfunktion zu.Die Besucher einer Veranstaltung befinden sich meist in einer für sie ungewohnten Umgebung und erleben dabei unterschiedlichste körperliche Beeinträchtigungen.
Eine schnelle und erste Hilfe mit einer fachgerechten Behandlung bis zur Übergabe an andere Einsatzkräfte prägt das Bild der Versorgung entscheidend. Daher sind in allen Bereichen der Großveranstaltung, z.B. in parzellierten Zuschauerbereichen, dem Bühnen- und Backstage-Bereich sowie den Zu- und Ausgängen mit den angrenzenden Verkehrsflächen Sanitätsposten in ausreichender Anzahl einzusetzen.
Neben den Funktionen als Ansprechpartner sind diese mobilen Posten ebenfalls in der Lage, immobile Patienten aufzusuchen. Diese Posten arbeiten im Team - Dreiergruppen haben die höchste Arbeitssicherheit - eigenverantwortlich unter einer Abschnittsführung. Jedem dieser Abschnitte ist eine ausreichende Anzahl von Trupps rettungsdienstlichen Versorgungsstufe zuzuordnen. Diese Trupps haben die Aufgabe, Patienten qualifiziert zu versorgen und den weiteren Versorgungsbereichen zuzuführen.
Dazu ist bereits eine hochwertige medizinische Ausstattung und eine entsprechende Ausbildung notwendig. Trupps mit einer Trage sind möglichst mit Personalreserve zu versehen, da oft über Kopf und über lange Strecken getragen werden muss.
1.2 Unfallhilfstelle
Je nach örtlichen Verhältnissen, der Größe der Veranstaltung und der Witterung ist die Einrichtung einer oder mehrerer Unfallhilfstellen erforderlich. Diese räumlich fixierten und abgeschlossenen Versorgungseinrichtungen dienen der vorübergehenden Unterbringung von Patienten und der Betreuung sowie als Durchgangsstelle für die Zuführung zu einem Krankenhaus. Eine umfangreiche medizinisch-technische Ausstattung sowie die Besetzung mit ärztlicher Kompetenz ermöglicht eine weitgehende Betreuung zur Entlastung des Rettungsdienstes und der Krankenhäuser.1.3 Notarzt-Dienst
Neben der ärztlichen Besetzung der Unfallhilfstellen ist es ggf. erforderlich, auch mobile Notärzte (NA) für die Sicherung einer Grossveranstaltung vorzuhalten. Dies gilt gerade dann, wenn es sich um besonders gefahrengeneigte Veranstaltungen handelt. In Abhängigkeit von den Örtlichkeiten kann der Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), eines Zweirad oder schlicht einer Fussgruppe sinvoll sein.1.4 Betreuungsbereich
Je nach Struktur ( Alter und Soziologie ) der aktiven Veranstaltungsteilnehmer und Besucher sowie der Art des Programms ergibt sich die Notwendigkeit zur Einrichtung einer Betreuungsstelle, in der Personen vorübergehend betreut werden. Dies ist ggf. in Verbindung mit der Unfallhilfstelle zu realisieren. Ausgedehnte Betreuungsbereiche sind beispielsweise bei Grossveranstaltungen mit Kindern oder im Bereich des Straßenkarneval notwendig.1.5 Transportbereiche
Eine Reihe von Patienten muss nach der Erstversorgung vor Ort in ein geeignetes Krankenhaus eingeliefert werden. Dazu sind ausreichende Transportkapazitäten an definierten Stellen unter einer zentralen Leitung vorzuhalten. Hiermit sind sowohl Transporte innerhalb als auch ausserhalb des Veranstaltungsbereichs abzuwickeln. Zu diesem Aufgabenbereich gehören ebenfalls die Sicherung der Zu- und Abfahrten für die Rettungsmittel, die Organisation eines oder mehrerer Krankenwagenhalteplätzen sowie eines Hubschrauberlandeplatz.1.6 Technischer Dienst
Grossveranstaltungen mit einer Vielzahl von Teilnehmern und Helfern erordern immer auch eine logistische Unterstützung durch technische Dienste. Viele Veranstaltungsorte verfügen nicht über die notwendige technische Infrastruktur zur Versorgung aller einzurichtenden Funktionsbereiche mit Strom, Licht und Klima. Daneben ergeben sich im Einzelfall technische Probleme bei der Verlegung von Kabeltrassen für die Kommunikationswege oder der Aufstellung sonstiger Einrichtungen wie Materialdepots, Räumlichkeiten der Einsatzleitung oder Aufenthaltsräumen. Zur Übernahme dieser Aufgaben bieten sich beispielsweise als einzelne Organisation das THW oder die Freiwilligen Feuerwehren sowie fachdienstübergreifende Einheiten an.1.7 Kommunikation
Jedem Praktiker ist der enge Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten einer leistungsfähigen und umfassenden Kommunikation und dem Einsatzerfolg bekannt. Der Ausgestaltung dieses Aufgabenbereiches ist daher besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Kommunikationswege müssen immer in beide Richtungen nutzbar sein. So muss die Einsatzleitung zu jeder Zeit in der Lage sein, Einsatzaufträge abzusetzen. Andererseits ist sie zur Wahrnehmung ihrer Führungsfunktion auf Rückmeldungen aus den Abschnitten angewiesen. Die Kommunikationswege haben sich an der Führungsorganisation zu orientieren und müssen allen Beteiligten rechzeitig bekannt sein. ( Fernmeldeskizze ) Gleiches gilt für die Verbindung nach aussen, hier insbesondere zur Rettungsleitstelle, aber auch zu allen anderen mitwirkenden Behörden und Organisationen. Zur schnellen Entscheidungsfindung bietet sich, soweit man keine gemeinsame Einsatzleitung einrichtet, der Einsatz von Verbindungskräften in der Einsatzleitung des jeweils anderen an.1.8 Einsatzleitung
Zur Koordination aller Aufgabenbereiche und zur planmässigen Einsatzabwicklung ist eine gut ausgestattete Einsatzleitung erforderlich. Zu personellen und sächlichen Ausstattung einer solchen Einsatzleitung (EL) gibt es in der Literatur zahlreiche Hinweise. Den Führungskräften der Behörden sowie der Hilfsorganisationen sind die Stabsmodelle des Katastrophenschutzes sowie die Vorschläge zur Einrichtung einer Technischen Einsatzleitung hinreichend bekannt. Bei einer Vielzahl von Einsätzen haben sich diese Modelle bewährt und können zur Nachahmung nur empfohlen werden. Es ist sicherzustellen, dass die Einsatzleitung in festen Räumlichkeiten untergebracht ist. Der Standort der EL sowie die übrigen Einrichtungen muss allen erforderlichen Helfern und Führungskräften bekannt sein. An dieser Stelle sei noch auf zwei besonders wichtige Aspekte hingewiesen: Eine umfassende Dokumentation aller Einsatzmassnahmen und Entscheidungen sowie der wesentlichen Abläufe ist neben einer lückenlosen Registratur aller Verletzten sicherzustellen. Nur so lässt sich eine sinnvolle, in jedem Fall durchzuführende Nachbereitung zur dauerhaften Qualitätssicherung und juristischen Absicherung gewährleisten.1.9 Versorgung, Verpflegung, Entsorgung
Aus der Gefahrenanalyse der zu betreuenden Grossveranstaltung ergibt sich die Spezifizierung der vorzuhaltenden Ausrüstungsgegenstände (Tragen, Beatmungseinheiten, Monitoring), der Verbrauchsgüter sowie der zur Versorgung der Helfer eingesetzten Mittel. Dabei darf auch der Aspekt der Entsorgung (medizinischer Abfall, Toiletten) nicht vernachlässigt werden.1.10 Erweiterte Massnahmen beim Massenanfall
Die Einsatzplanung ist so zu gestalten, dass die zu etablierenden Strukturen für das erwartete Einsatzaufkommen greifen. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die bei einem Massenanfall von Verletzten additiv einzubindenden externen Strukturen problemlos eingegliedert werden können. Es ist im Vorfeld zu bestimmen, wo die bei einem Massenanfall von Verletzten einzurichtenden Versorgungsbereiche positioniert werden sollen und wer die Einsatzleitung übernimmt. Es ist zu klären, ob und inwieweit zusätzlich zu den eigenen Massnahmen zur rettungsdienstlichen Betreuung einer Veranstaltung auch eine Verstärkung des Rettungsdienstes erfolgen muss.2. Einsatzplanung
Informationen sind zu folgenden Punkten notwendig:- Programmablauf und Zeitplan des Veranstalter
- Informationen über eigene Sicherheitsstandards des Veranstalter
- Planunterlagen mit Angaben der Sperrzonen, Flucht- und Rettungswege
- Benennung der Ansprechpartner und Erreichbarkeit
- Örtliche Versorgungsmöglichkeiten und Materialdepots
- Vorhandene Fernmelde- und Kommunikationsmöglichkeiten
- erwartete Besucherzahl
- Art, Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung
- Beschreibung der Vorgaben des Veranstalters bzw. der Ordnungsbehörde
- Beschreibung des Umfangs der RD-Aufgaben
- Benennung aller beteiligten Behörden und Organisationen
- Gesamtübersicht der eingesetzten Kräfte
- Einsatzleitung - Standort, Ausstattung, Erreichbarkeit
- Beschreibung aller einzurichtenden Aufgaben- und Funktionsbereichen mit Standort, Ausstattung, Erreichbarkeit und Art der Unterstellung
- Zeitliche Ablaufplanung des Einsatzes, insbesondere der Bereitstellungszeiten
- Kommunikationseinrichtungen, Funkkanäle, Rufnummern, Fernmeldeskizzen Bereitstellung einsatzrelevanter Informationen Grundrisspläne, graphische Aufbereitung einsatztaktischer Besonderheiten.
3. Gefahrenanalyse
Die wichtigsten Faktoren die die von einer Grossveranstaltung ausgehenden Risiken beeinflussen:- Besucherzahl - zulässige und tatsächliche
- Veranstaltung in geschlossenen Räumen oder im Freien
- Gefahrenneigung nach Art der Veranstaltung
- Beteiligung prominenter Persönlichkeiten mit Sicherheitsstufe
- Berücksichtigung polizeilicher Erkentnisse
Der Schlüssel für die Zuordnung der Punktewerte zu den das Risiko beschreibenden Parametern wurde aufgrund einer Analyse von über 60 unterschiedlichen Veranstaltungsorten und -arten sowie von Schadensfällen der Vergangenheit ermittelt.
Dabei wurde berücksichtigt, dass die einzelnen Parameter in einer dem jeweiligen Risiko entsprechenden Relation zueinander stehen. Auf diese Weise werden Risikofaktoren gegenseitig bewertbar.
3.1 Besucherzahl
3.1.1 maximal zulässige Besucherzahl
Ergibt sich aus:- bauseitigen Auflagen
- Bestuhlung
- zugelassene Sitz- oder Stehplätze
- bei Freigelände: 4 Personen pro Quadratmeter
| Bis 500 Besucher | 1 Punkt |
| Bis 1000 Besucher | 2 Punkte |
| Bis 1500 Besucher | 3 Punkte |
| Bis 3000 Besucher | 4 Punkte |
| Bis 6000 Besucher | 5 Punkte |
| Bis 10000 Besucher | 6 Punkte |
| Bis 20000 Besucher | 7 Punkte |
Für jeweils weitere 10000 Teilnehmer erhöht sich der Punktewert um 1.
Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume wird der Punktewert verdoppelt.
Der so ermittelte Punktewert beschreibt das vom Ort der Veranstaltung ausgehende Risiko.
3.1.2 tatsächliche oder zu erwartende Besucherzahl
Ergibt sich aus:- Kartenverkauf
- Erfahrungswerte
- der zur Verfügung stehenden Freifläche, hier
- mit 2 Personen pro Quadratmeter
3.2 Gefahrenneigung nach Art der Veranstaltung
Zur Abschätzung des durch die Art der Veranstaltung bestimmten Risikos wird der das Risiko beschreibende Punktwert mit einem Bewertungsfaktor gewichtet. Eine Anpassung der Faktoren an örtliche Verhältnisse ( gewaltbereites Publikum ) und Erfahrungen ist möglich und notwendig.| Art der Veranstaltung | Multiplikator |
| Allgemeine Sportveranstaltung | 0,30 |
| Ausstellung | 0,30 |
| Basar | 0,30 |
| Demonstrationen | 0,80 |
| Feuerwerk | 0,40 |
| Flohmarkt | 0,30 |
| Flugveranstaltung | 0,90 |
| Karnevalsveranstaltung | 0,70 |
| Karnevalszug | 0,70 |
| Kombi-Veranstaltung (Sport-Musik-Show) | 0,35 |
| Konzert | 0,20 |
| Kundgebung | 0,50 |
| Langlauf | 0,30 |
| Martinszug | 0,30 |
| Messe | 0,30 |
| Motorsportveranstaltung | 0,80 |
| Musikveranstaltung | 0,50 |
| Oper/Operette | 0,20 |
| Radrennen | 0,30 |
| Reitsportveranstaltung | 0,10 |
| Rockkonzert | 1,00 |
| Schauspiel/Theater | 0,20 |
| Schützenfest | 0,50 |
| Show | 0,20 |
| Stadtteilfest | 0,40 |
| Strassenfest | 0,40 |
| Tanzsportveranstaltung | 0,30 |
| Volksfest | 0,40 |
| Weihnachtsmarkt | 0,30 |
3.3 Beteiligung prominenter Persönlichkeiten
Findet eine Veranstaltung unter Beteiligung von Prominenten statt, so ist für je 5 Prominente ein Punktwert von 10 Punkten zu berechnen.3.4 Berücksichtigung polizeilicher Erkentnisse
Je nach der Zusammensetzung der zu erwartenden Besuchergruppe ergeben sich polizeiliche Erkentnisse über die Gewaltbereitschaft der Teilnehmer. Ist dies aus Abstimmungsgesprächen erkennbar, so ist der das Risiko beschreibende Punktwert um weitere 10 Punkte zu erhöhen.Sinnvolle Einsatzplanung bei Grossveranstaltungen
Anschrift des Verfassers:
Oberbranddirektor Dipl.-Ing. Klaus Maurer
Leiter der Feuerwehr Hamburg
Westphalenweg 1
20099 Hamburg